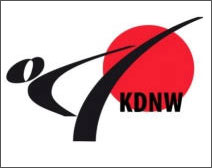Warum ich Karate mache
Ich bin eine Karate-Späteinsteigerin und habe erst vor zwei Jahren mit 42 Jahren meine Liebe zum Kampfsport entdeckt. Dazu gekommen bin ich über Freunde, die mir und einer Freundin vom Jukengo vorgeschwärmt haben. Nicht nur vom Training, sondern auch von den netten Absackern danach im „Kuen“ und den gemeinsamen Wochenenden im Westerwald, mit Karate, Kölsch, Kindern und langen Nächten am Lagerfeuer. Wahrscheinlich hat mich das überzeugt, denn in Sachen Karate hatte ich eine eher krude Vorstellung – irgendeine Mischung aus Karate Kid, Bruce Lee und synchron tanzenden Shaolin-Mönchen. Das ganze begleitet von komischen Geräuschen.
Ich habe mich trotzdem getraut und war schnell in den Bann gezogen. Da war die nette Anfängergruppe, in der ich mich schnell wohlgefühlt habe. Zwei sehr unterschiedliche und tolle Trainer, Liesel und Felix, die uns mit viel Geduld und jedem in seinem Tempo in die Grundlagen eingeführt haben – und uns vor allem an ihrer Begeisterung für Karate haben teilhaben lassen, so dass bald der Funke übersprang.
Mich hat schnell die Vielfältigkeit des Trainings fasziniert. Karate tut körperlich gut, sorgt für Muskeln, Gelenkigkeit und eine gute Körperhaltung. Es schärft die Koordination und trainiert so auch das Gehirn. Dazu die Konzentrationsfähigkeit, die man wie nebenbei trainiert. Wie wohl die meisten habe ich einen recht stressigen Alltag und es ist super, sich abends im Training zu fokussieren – auf den Partner, mit dem man gerade trainiert. Die Atmung. Die Technik. Karate zu prakizieren bedeutet für mich auch, für den Moment alles andere auszublenden.
Das half mir auch darüber weg, dass am Anfang eigentlich gar nichts klappte. Ich hatte nicht nur zwei linke Hände, sondern auch linke Arme, linke Beine, linke Schultern (…) und die Bauchspannung hatte eher Pudding-Qualitäten. Ehrlich gesagt, die ersten Monate waren ziemlich harte Arbeit, aber als ich dann die erste Gürtelprüfung bestanden habe, war das „Geschaft‐Gefühl“ umso so schöner. Aber dann geht es weiter und weiter und es bleibt Arbeit. Karate ist kein Fun-Sport, den man mal nebenbei im Fitnessstudio trainiert, sondern mehr. Eine Übung in Disziplin, in der Bereitschaft zur Veränderung.
Dabei ist es aber nicht spaßfrei, im Gegenteil, es macht sogar Riesenspaß und auf Dauer richtig süchtig. Aber es ist eine stetige Herausforderung. Je mehr du lernst, desto mehr erkennst du, was du noch verbessern kannst. Es hört nie auf, auch wenn du Schwarzgurt oder Trainer bist (habe ich mir von den Trainern sagen lassen).
Ich persönlich werde wohl nie ein schönes Karate machen oder „richtig“ gut werden, dafür habe ich zu spät damit angefangen. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es geht nicht darum, vor anderen zu glänzen oder mich mit anderen zu messen, sondern an mir selbst zu arbeiten. Der stete Wille zur Verbesserung, die Hartnäckigkeit in winzigen Schritten vorwärts zu kommen und stets dabei zu bleiben, das wird nach und nach auch zu einer Haltung, die weit über das Training hinaus geht.
Mir hilft diese Karate-Haltung zum Beispiel auch beruflich. Ruhig bleiben in konfliktreichen Situationen, vom Gegenüber lernen, in Herausforderungen die Energie sinnvoll einsetzen – all das diffundiert langsam von der Sporthalle in mein tägliches Leben.
Das alles und dazu die vielen netten Abende und neuen Freundschaften – ich bin wirklich froh, dass ich mich damals für den Jukengo entschieden habe.